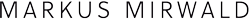„Der vielleicht größte Schatz“ von Markus Mirwald eignet sich nicht für den unserer beschleunigten Zeit entsprechenden Buchkonsum. Der Literaturkonsument des 21. Jahrhunderts scheitert mit seinem Habitus schon auf Seite Eins.
Das Buch ist ein ästhetisches und kontemplatives Geschenk, insofern ein Anachronismus, der zum Stutzen bringt, was der Autor ja vermutlich auch im Sinn führte – keines zum gewohnt schnellen Ein- und Durchlesen. Man bleibt auf der ersten Seite hängen, und das nicht einmal bei dessen Inhalt, vielmehr zuerst noch bei der Erkenntnis, den Inhalt dieses Buch nur durch die Bereitschaft erobern zu können, ihm Zeit zur Entfaltung seiner Wirkung zu geben.
Markus Mirwald hält auf jeder Seite einen Moment lang die Zeit an, hinterfragt sie aus einer gewissen Perspektive, also jene Zeit, in der wir die Gestalter sind und in der wir uns so häufig mit unseren Gestaltungen verirren.
Aber er lässt sich nicht dazu verleiten, uns zu beratschlagen, erhebt nicht den Zeigefinger, nein, er geht nicht so weit, sondern viel weiter: Er baut uns schmale Pfade, die uns selbst zu Einsichten führen. Seine „Wegbeschreibungen“ könnten in einem Verbandskasten auf den Wegen durch unsere Zeit gut aufgehoben sein; man lege sich täglich nur einen Aphorismus wie eine langsam aufzulösende Pille unter die Zunge.
Das Verstehen stellt sich allmählich ein. Die Verwandlung des Selbst in einen tiefgründigeren Menschen möglicherweise durch Langzeitwirkung?